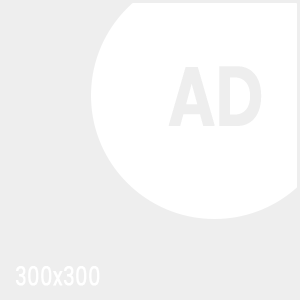Ob auf einem Wochenendtrip oder auf Langfahrt: die Energieversorgung ist seit jeher neben der Versorgung mit Trinkwasser einer der Faktoren, welcher die Dauer eines Törns ohne Zwischenstop in Marinas limitiert. Das Energiemanagement auf Yachten besteht grundsätzlich aus drei Komponenten: Verbrauchern, Speichern und Erzeugern.
Noch vor einigen Jahren war es mit simplen Nassbatterien als Speicher, Glühlampen als Verbrauchern und dem Bordmotor als Erzeuger wirklich schwierig, länger autark zu bleiben. Dank des technischen Fortschritts bei Speichern (AGM-und jetzt auch Lithium-Batterien), Verbrauchern (effizientere Kühlschränke, LED-Beleuchtung) sowie Erzeugern (Solarpanel, Windgenerator, Schleppgenerator, Ladebooster…) kann dauerhafte Autarkie bezüglich elektrischer Energie leicht erreicht werden.
Im Folgenden gebe ich einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des Energiemanagements sowie Hilfestellungen zur idealen Gestaltung des eigenen Systems.
Inhalt
Kenne deinen Energiebedarf
Um das Setup für die eigene Yacht ideal zu dimensionieren, muss als erstes der zu erwartende Energiebedarf festgestellt werden. Dieser hängt von den eingesetzten Verbrauchern und der Dauer ihres Betriebs unter den erwarteten Bedingungen ab. Festgestellt werden kann der Energiebedarf entweder berechnet (z.B. hat unser WLAN-Router eine Leistungsaufnahme von 3 Watt, was einem Strom von 0,25A bei 12V Spannung entspricht) oder beobachtet (unser Kühlschrank verbraucht in etwa 50 Amperestunden je 24 Stunden – das entspricht etwas mehr als 2 Ampere im Durchschnitt). Eine Beispielrechnung des Energiebedarfs für unser Boot sieht also so aus:
- Kühlschrank (dauerhaft): 50 Ah
- WLAN-Router (dauerhaft) : 8Ah
- Batteriemonitor-Rechner (dauerhaft): 8Ah
- Navi-Rechner: (dauerhaft) 8Ah
- Beleuchtung: (4h je Tag) 8Ah
- Wasserpumpe (0,25h je Tag): 2Ah
- Funkgerät (8h je Tag): 4 Ah
- GPS (8h je Tag): 6 Ah
- Log, Sonar, Windmesser (8h je Tag): 8Ah
- Handy, iPad, Laptop laden: 5 Ah
Dies Entspricht einem Gesamtverbrauch von rund 105 Ah je Tag (24 Stunden) bei für uns normalem Dauereinsatz. Multipliziere ich nun den ermittelten Bedarf mit der gewünschten Dauer, die ich unabhängig von Landstrom zu verbringen in der Lage sein möchte, so kenne ich die Gesamtenergie, welche ich zu speichern und/oder zu erzeugen habe. Wir wollen z.B. mindestens eine Woche ohne Stop in Marinas verbringen können und haben daher einen Gesamtenergiebedarf von ca. 735 Ah.
Energie speichern oder selbst mobil erzeugen
Das Nutzungsprofil von Yachten ist sehr unterschiedlich. Durch unseren Wunsch, 7 Tage autark verbringen zu können benötigen wir sehr viel mehr Energie „am Stück“ als derjenige, der von marina zu Marina segelt und praktisch nie über Nacht autark bleiben möchte (735 Ah Gesamtbedarf bei uns vs. 105Ah (bei identischem Setup) bei dem imaginären „Daycruiser“). Berücksichtigen wir dabei, dass eine normale 200 Ah fassende AGM-Bettrie bereits gerne 60kg wiegt und, um sie zu schonen, nur maximal zu 50% entladen werden sollte, liefe dies bei reiner Ladung püber Landstrom auf mindestens 7 solche Batterien, also 7*60 =420kg Bleibatterien hinaus. Das wäre wahnsinnig schwer, teuer, ressourcen-unfreundlich und nähme uns sehr viel Platz weg. Der „Daycruiser“ hingegen kommt mit einer einzigen solchen Batterie gut hin und ist damit auch am günstigsten bedient.
Die Lösung kann also in unserem Fall nur sein, die Tagesbilanz so zu verändern, dass wir „netto-null“ sind, also jeden Tag die Energie erzeugen, die wir benötigen.
Mobile Stromerzeugung auf Yachten
Für die mobile Stromerzeugung stehen uns mehrere Optionen zur Verfügung. In Kurzform sind hier am relevantesten:
- Lichtmaschine des Motors
- + In der Regel standardmäßig bereits montiert
- + Meist hohe Ladeströme (>= 30 Ampere)
- + Jederzeit einsatzbereit
- + automatisches Laden beim Motoren
- – Motor muss laufen
- – Lärm
- – Ressourcenverbrauch (Kraftstoff)
- Solarzellen
- + Immer automatisch aktiv
- + bei Sonnenschein hohe Energieausbeute
- + kein fortlaufender Ressourcenverbrauch
- – Investment notwendig
- – geeigneter Installationsort notwendig (Geräteträger, Reling…)
- – bei starker Bewölkung wenig Ausbeute
- Genrator
- + sehr hoher Ladestrom
- + leiser als Bordmotor
- – teuer
- – Ressourcenverbrauch (Kraftstsoff)
- – Aufwendige Installation
- Windgenerator
- + Immer automatisch aktiv
- – Schmales Windfenster, in dem er relevante Leistung liefert
- – Vibrationen im Betrieb
- – Relativ teuer
- Schleppgenerator
- + Kein Ressourcenverbrauch
- + Relevante Leistung beim Segeln
- – Teuer
- – Nur beim Segeln aktiv
- – Aufwendige Installation
Diese kurze Übersicht zeigt, dass die Kombination aus einer starken Lichtmaschine an der Einbaumaschine und ggf. Solarzellen die am besten geeigneten und effizientesten mobilen Lademöglichkeiten darstellen. Erst wenn diese beiden Optionen ausgenutzt sind, empfiehlt es sich, auch andere Lademöglichkeiten in Betracht zu ziehen.
Wir haben bei uns eine starke Lichtmaschine (mind. 30A Ladestrom, wenn der Motor läuft) und Solarmodule mit insgesamt 360 Watt Peak installiert. Selbst in der nördlichen Ostsee (Estland, Finnland, Schweden) haben wir mit den Solarmodulen rund 80 Ah pro Tag bei etwas Sonne gewonnen. Wenn dann noch ab und zu der Motor läuft (An- und ablegen, einige Strecken motoren) haben wir fast jeden Tag die Batterien wieder auf 100% geladen.
Die richtigen Batterien auf Segelyachten
Die Batteriespeichertechnik hat sich in den vergangenen Jahren massiv weiterentwickelt. Getrieben durch den großen Bedarf aus der Automobilindustrie sind insbesondere Lithium-Eisenphosphatbatterien mittlerweile auch für Anwendungen im Yachtbereich erschwinglich geworden.
Batterien an Bord sollten idealerweise folgende Eigenschaften mitbringen:
- Ausreichend (nutzbare!) Kapazität
- Ausreichend hohe Entladeströme
- Möglichst hohe mögliche Ladeströme
- Geringes Gewicht
- Temperaturfestigkeit
- Zuverlässigkeit / Sicherheit
- Zyklenfestigkeit
- Günstiger Preis
Leider gibt es nicht die eine Eier legende Wollmilchsau. Daher sollen die in Frage kommenden Optionen kurz dargestellt werden.
AGM- oder Gelbatterien
Diese beiden Technologien sind sich im Grunde recht ähnlich. Sie sind verhältnismäßig günstig (ca. 4€ je Ah nutzbarer Kapazität), sollten jedoch maximal zur Hälfte entladen werden, um die Zyklenfestigkeit (Haltbarkeit) nicht zu sehr zu strapazieren. Sie haben eine Haltbarkeit von ca. 500 Zyklen bei 50% Entladung. AGM.- und Gelbatterien sind schwer (ca. 0,5kg je nutzbarerAh).
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFEPO4-Batterien)
Diese Batterien sind ein wahrer Quantensprung in der Entwicklung der Batterietechnik. Sie haben ein deutlich geringeres Leistungsgewicht (ca. 0,125kg je nutzbarer Ah – etwa fünfmal so viel wie vergleichbare AGM; Batterien) sowie eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit (ca. 4.000 Zyklen). Im gegensatz zu Bleibatterien kann bei LiFePO4-Batterien bis zu 100% der Nennkapazität genutzt werden, ohne die Langlebigkeit stark zu beeinträchtigen. Ein weiterer Vorteil sind die sehr hohen möglichen Ladeströme. Lithium-Batterien können bei entsprechend starkem Ladegerät (Solar, Lichtmaschine, Landstrom…) sehr schnell laden und damit verfügbare Ladegeräte ideal ausnutzen. Der Preis pro nutzbarer Ah liegt bei rund 8-10€.
Ein Beispiel verdeutlicht die Unterschiede der beiden Batterietechnologien. Gehen wir von einem Bedarf von 200 Ah nutzbarer Energie Dies bedeutet in etwa (Lithium vs. AGM):
- Preis: 1.800€ vs. 800€
- Gewicht: 25kg vs. 120kg (!)
- Zyklenfestigkeit: 4.000 vs. 500 Zyklen
Zusammenfassung
Soll heute in eine neue Batteriebank investiert werden, so sind Lithium-batterien dann im Vorteil, wenn
- der Energiebedarf hoch ist
- die erwartete Nutzung intensiv ist (Zyklenfestigkeit)!
- Gewicht und/oder Platz eine Rolle spielt
- Die Effiziente Nutzung der verfügbaren Ladeoptionen wichtig ist
Wir haben noch nicht auf Lithium umgebaut, da die verbauten AGM-Batterien bisher noch ausreichten. Wir werden es aber in Kürze vornehmen, vornehmen, da die Batterien nun schon einen signifikanten Teil ihrer Nenn-Kapazität verloren haben und wir mit größeren Verbrauchern (Brotbackautomat, Warmwasser-Boiler, ggf. in Zukunft elektrisch Kochen) unsere verfügbare Solarenergie noch besser ausnutzen und so weit wie möglich auf fossile Energie (Motor zum Laden, Gas zum Kochen) verzichten möchten.